Taufrisch ist sie nicht mehr, die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die weltweit zu einem Muster des Datenschutzes geworden ist. Sie will uns vor Datenmissbrauch schützen und regelt europaweit, wie wir mit den Daten unserer Partner umgehen.
Desinteresse und Lässigkeit traten an die Stelle von Angst und Aufregung

Als die Übergangsfrist im Mai 2018 auslief, war die Aufregung und die Angst groß. Fast jeder fürchtete eine Abmahnwelle.
Doch seither haben viele die DSGVO wieder aus den Augen verloren:
Strafen und Kontrollen blieben ja scheinbar aus…
Der eine oder andere nimmt sie nicht wirklich ernst…
Mancher kennt sie gar nicht…
Und doch – der Verstoß gegen die Regelungen der DSGVO kann nach wie vor teuer werden. Daher lohnt sich ein Blick auf die Rechtslage und darauf, was die DSGVO von Vermietern zum Beispiel verlangt:
Diese Grundsätze prägen die DSGVO
- Der Grundsatz der Datensparsamkeit
- Der Grundsatz des berechtigten Interesses
- Die Pflicht zu Transparenz und Vereinbarung über das Erheben, Nutzen und Speichern von Daten
- Sichere Aufbewahrung von Daten
Grundsatz der Datensparsamkeit

Die Datenschutzgrundverordnung verpflichtet alle im Immobiliengeschäft Tätige wie Vermieter, Verwalter, Handwerker oder Makler zum Grundsatz der Datensparsamkeit.
Es gilt also grundsätzlich, daß Sie so wenige Daten wie möglich erheben und speichern sollten.
Grundsatz des berechtigten Interesses
Viele lassen sich von dem Grundsatz leiten, das könnte ja mal wichtig werden und sammeln munter vor sich hin. Das erlaubt die DSGVO nicht. Sie müssen relevante Informationen auswählen.
Wie wählen Sie nun aus, welche Daten Sie bei Ihrem Gegenüber erfragen (erheben) und notieren (abspeichern)? Welche Informationen sind wichtig und notwendig? Welche Informationen helfen Ihnen bei einer konkreten Auswahl oder einem konkreten Angebot?
Solche ganz konkreten Überlegungen führen zu einem „berechtigten Interesse“ und erlauben Ihnen – über das absolute Minimum hinaus – mehr Daten vom Gegenüber zu erbitten und auch abzuspeichern.
Die Pflicht zu Transparenz und Vereinbarung über das Erheben, Nutzen und Speichern von Daten
Genauso wichtig ist es, das Gegenüber darüber zu informieren, was Sie warum erfragen, nutzen und abspeichern. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang, dem Gegenüber mitzuteilen welche Daten Sie notieren, also abspeichern, oder sogar einen Beleg über die gespeicherten Daten zur Verfügung zu stellen. Dies sollten Sie zu ihrem eigenen Schutz auch mit einer Erlaubnis zur Datennutzung und Datenspeicherung verbinden.
Damit geht auch einher, daß Sie nicht benötigte Daten löschen und diese auch auf Aufforderung des Gegenübers löschen. Dazu sind Sie laut DSGVO verpflichtet.
Sichere Aufbewahrung von Daten
Und schließlich gehört zu Ihren Pflichten laut DSGVO auch die sichere Aufbewahrung der Daten. Physische Daten wie Informationsbögen sollten Sie für Dritte uneinsehbar aufbewahren, z.B. in einem abschließbaren Schrank. Digitalisierte Daten dagegen müssen verschlüsselt werden.
Was bedeutet das denn konkret?
Beispiel: Besichtigung

Nehmen wir an, Sie wollen eine Wohnung vermieten und bieten eine Besichtigung an. Für eine solche Besichtigung brauchen Sie eigentlich nur zwei Informationen (Daten), den Namen des Mietinteressenten und seine Telephonnummer oder eMail, also seine Kontaktdaten.
Der Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet Sie, auch nur diese zwei Informationen zu notieren.
Beispiel: Wohnung mit Besonderheiten

Weist Ihre Wohnung Besonderheiten auf, wie zum Beispiel Barrierefreiheit, dann können Sie unter den Mietinteressenten jene auswählen, für die diese Besonderheit wichtig sein könnte.
Vielleicht ist Ihnen ja wichtig, daß der künftige Mieter auch wirklich ein in diesem Sinne Bedüftiger ist.
In diesem Fall liegt damit ein berechtigtes Interesse vor. Sie können deshalb weitere Daten erfragen, die dafür wichtig sind.
Prüfen Sie genau, welche Daten dabei relevant sind, denn es gilt der Maßstab der Verhältnismäßigkeit. Die Kontodaten sind für diesen konkreten Fall nicht relevant, sollten also nicht abgefragt werden, aber eine körperliche Einschränkung durchaus.
Das dürfen Sie nicht nur erfragen, sondern auch notieren, weil Sie diese Infos dank des berechtigten Interesses begründen können.
Beispiel: Der Mietinteressent übergibt Ihnen unaufgefordert umfassende Selbstauskünfte
Gerade in den Zeiten des Wohnungsmangels bieten viele Mietinteressenten unaufgefordert ausführliche Selbstauskünfte an, die für das Mietverhältnis nicht von Bedeutung sind. Auch wenn der Interessent das freiwillig anbietet, müssen Sie diese Informationen ablehnen oder löschen – wenn kein berechtigtes Interesse vorliegt.
Was gilt für die Weitergabe von Daten an Dritte?
Zähler sollen abgelesen werden? Eine Reparatur steht an? Die Beteiligten einen Termin direkt vereinbaren zu lassen ist eine erhebliche Erleichterung für jeden Vermieter.
Doch Halt: Eine einfache Weitergabe an Dritte – ohne Erlaubnis – ist nicht erlaubt, weil es sich – aus rechtlicher Sicht – um eine Datenverarbeitung handelt. Damit ist es Ihre Aufgabe, diesen Termin zwischen beiden Parteien auszuhandeln.
Sie können Sie das Leben leichter machen, wenn Sie sich eine Erlaubnis für den konkreten Fall oder den Handwerker einholen. Umgekehrt ist es oft leichter, sich die Erlaubnis des Handwerkers einzuholen. Seine Daten sind ohnehin meist öffentlich und er hat auch ein Interesse daran, bekannt zu sein oder zu werden. Fragen Sie dennoch nach, ob Sie seine Kontaktdaten an den Mieter weitergeben können. Dann kann der Mieter anrufen und direkt einen Termin vereinbaren.
Beispiel: Dienstleister
Arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen, zum Beispiel um Zähler abzulesen, dann müssen Sie auch das rechtlich regeln. Das geschieht mit Hilfe eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages. Die meisten Dienstleister haben einen solchen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf ihren Webseiten als Download für ihre Vertragspartner. Alternativ können Sie Musterverträge auch hier finden: www.bvdnet.de/wp-content/upload/2017/07/Muster-AV-Vertrag.doc.
Informieren Sie Ihren Mieter über diese Zusammenarbeit.
Erlaubnis zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung immer schriftlich
„Es ist ja so umständlich….“, stimmt. Es ist umständlich, sich vom Gegenüber eine schriftliche Erlaubnis rundum die Datenverarbeitung erteilen zu lassen. Doch das gilt nur, solange, wie es noch keine Gewohnheit ist.
Spätestens wenn Sie sich einmal eine blutige Nase geholt haben, dann wirken solche Verträge nicht mehr umständlich und lästig. Menschen ändern ihre Meinung und Menschen sind vergesslich. Was heute o.k. ist, ist es morgen möglicherweise nicht mehr. Daher gilt für alles rund um die DSGVO: Wer schreibt, bleibt! Lassen Sie sich immer eine schriftliche Erlaubnis geben, die Daten abfragen, speichern und nutzen zu dürfen. Es kann teuer werden, das nicht zu tun.
Und bitte, seien Sie vorsichtig mit Kontakt-Apps wie Whats-App und Facebook. Gerade diese sind bekannt dafür, im Hintergrund Daten weiterzugeben. Dafür sind Sie verantwortlich und werden auch rechtlich dafür verantwortlich gemacht. Das kann teuer werden. Sichern Sie sich dafür ab.
Wie holen Sie die Erlaubnis ein?
Ich bin keine Rechtsexpertin und berate dementsprechend auch nicht. Hier gebe ich meine Erfahrungen an Sie weiter. Doch in der Praxis achte ich auf folgendes:
- Ich informiere auf meiner Webseite über meine Datenverarbeitungspraxis.
- In meinen Verträgen habe ich einen entsprechenden Passus eingefügt.
- Für meine journalistische und Blogger-Praxis arbeite ich mit einer schriftlichen Erklärung.
Wenn Sie mit einer eigenen Webseite arbeiten, dann achten Sie auf die Erläuterungen zum Datenschutz auf einer eigenen Seite, die prominent positioniert ist.
Gerade wenn Sie mit Musterverträgen arbeiten, sollten Sie Ihre Vorlagen auf Aktualität und einen entsprechenden Passus prüfen.
Halten Sie eine Erklärung bereit, in der Ihnen das Gegenüber die Nutzung seiner Daten erlaubt.
Informell gilt: Bei einer Terminbestätigung achten Sie auf einen entsprechenden Hinweis, daß der Andere Ihnen die Datenweitergabe erlaubt hat.
Und nun: Viel Glück bei der Umsetzung
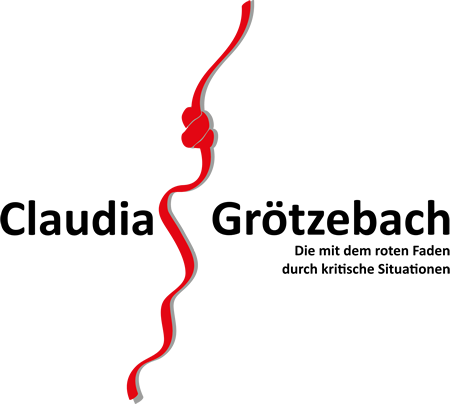

Neueste Kommentare